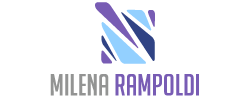Semantik der Grenze
Von Christoph Kleinschmidt, bpb, 13. Januar 2014. Wer einmal an einem Grenzübergang warten musste, bis der eigene Ausweis geprüft war und die Grenze passiert werden durfte, dem erschließt sich ihre Bedeutung als ein Zusammenhang von Staatsgebiet, Kontrollinstanz und Übergangszone. Mit dieser Erfahrung gelangt man an den Kern dessen, was Grenzen vor allem im 19. Jahrhundert bezeichneten und als was sie noch heute hauptsächlich definiert werden, nämlich territoriale Markierungen zur Absicherung von Macht, an denen der Hoheitsbereich des einen Staates aufhört und der eines anderen anfängt.
Darüber hinaus haben Grenzen aber in einem weit umfassenderen Sinne Bedeutung für das eigene Leben. Denn sie spielen nach landläufiger Meinung nicht nur in Fragen der Erziehung eine wichtige Rolle, sie strukturieren als Zeitfaktoren auch Arbeitsabläufe oder stellen im Geschichtsbewusstsein Einteilungskriterien im Hinblick auf persönliche wie epochale Zäsuren dar.

Grenzen fungieren zudem in unserem Rechtssystem als Vorschriften, die unseren sozialen Handlungsbereich organisieren und dabei regeln, in welchem Ausmaß die Freiheit des Einzelnen mit der Freiheit der Anderen vereinbar ist. In den Religionen dienen sie als ein Versprechen auf das, was jenseits menschlicher Endlichkeit liegt, und in der Wissenschaft motiviert die Überschreitung von Grenzen Forschung und Innovation. Sie kann allerdings auch apokalyptische Szenarien heraufbeschwören, wenn die Grenzen des Möglichen die Grenzen des Ethischen infrage stellen.
Nicht zuletzt zeigen Grenzen die Notwendigkeit an, den eigenen Zuständigkeitsbereich abzustecken und sich von anderen zu unterscheiden, sei es in individueller, kultureller oder politischer Hinsicht. Und auch das scheinbar grenzenlose World Wide Web und die Globalisierung lassen sich nicht ohne Grenzen denken, auch wenn es dabei eher um deren Negation geht beziehungsweise um eine ständige Verschiebung von Grenzen im Sinne variabler Netzwerkgemeinschaften und virtueller Profile.[1]
Grenzen gehören offensichtlich zu den Konstanten menschlichen Denkens und Handelns. In allen Bereichen jedoch nach einem gemeinsamen Bedeutungskern, nach der Semantik der Grenze zu fragen, stellt ein schwieriges Unterfangen dar, weil Grenzen zwar zur Identitätsbildung konstitutiv beitragen, sich selbst aber einer positiven Bestimmung entziehen. Als relationale Größen lassen sie sich in erster Linie in Abhängigkeit zu dem definieren, was sie einerseits unterscheiden und andererseits in ein Verhältnis zueinander setzen. So betrachtet stellen sie Figurationen des Dritten dar, die sich in ihrer Funktion als Abschluss paradoxerweise selbst nach zwei Richtungen hin öffnen.
Grenzen müssen darüber hinaus als komplexe Konstruktionen verstanden werden, die einer variablen Konsistenz unterliegen. Denn was eine Grenze ist und welche Bedeutung sie hat, hängt von den historischen und gesellschaftlichen Umständen ab, in denen sie auftritt. Die Wirksamkeit von Limes oder Berliner Mauer etwa unterliegt einer historischen Halbwertszeit und mit ihr zugleich die kulturelle Relevanz, die man ihnen als Grenze beimisst. Was in einem bestimmten Zeitraum den äußersten Rand des politischen Einflussbereichs markiert und damit eine existenzielle Bedrohung darstellt, kann zu einer anderen Zeit ein touristischer Programmpunkt unter vielen sein.
Mit der Einsicht in die grundlegende Konstruktion von Grenzen wird im Hinblick auf ihr Bedeutungsspektrum auch eine ihrer klassischen Unterscheidungen hinfällig, nämlich die zwischen natürlichen und künstlichen Grenzen. Der französische Historiker Lucien Febvre hat anhand von geografischen, militärischen und staatspolitischen Grenzen gezeigt, dass zwar eine typologische Differenzierung nach bestimmten Erscheinungsformen wie Flüssen, Schutzwällen oder Landmarken möglich ist, diese Grenzen jedoch nicht an sich existieren, sondern erst dazu gemacht werden.[2] Das mag besonders im Falle der natürlichen Grenzen irritieren, denn Bergkämme oder Küsten bilden doch eigentlich sehr markante landschaftliche Einschnitte. Sie werden allerdings nur vom Menschen in dieser Form erfahren, für andere Lebewesen bedeuten sie keine natürliche Einschränkung der Bewegungsfreiheit. Ebenso wie künstlich erzeugte Hindernisse unterliegt ihr Status als Grenze also kulturellen Setzungen und konventionellen Wahrnehmungsmustern.
Im Umkehrschluss bedeutet dieser Gedanke der Konstruktion, dass Grenzen der beständigen Verteidigung bedürfen, um als solche zu gelten. Das trifft für militärische Anlagen ebenso zu wie für symbolische Grenzen im Sinne von juristischen, religiösen oder sozialen Verhaltensnormen. Geschwindigkeitsverbote oder das Haltegebot an roten Ampeln beispielsweise sind zwar in der Straßenverkehrsordnung festgelegt, ihre Gültigkeit behalten sie allerdings nur dadurch, dass sie in polizeilichen Maßnahmen überprüft werden. Grenzen manifestieren sich demnach als konkrete Gebilde oder Handlungen, die auf einer gemeinschaftlichen Übereinkunft beruhen. Ändert sich diese jedoch, und zwar dadurch, dass sie nicht mehr kontrolliert und praktiziert wird, verlieren auch die Erscheinungsformen ihre limitierende Funktion. Die Zuschreibung als Grenze erlischt.
Solche Ambivalenzen sind charakteristisch für das semantische Profil der Grenze,[3] wobei eine ihrer wichtigsten Differenzen darin besteht, dass sie sowohl als scharfer Einschnitt gedacht werden kann als auch als ein dehnbarer Ort der Überschreitungen. Ein Gartenzaun, der zwei benachbarte Grundstücke voneinander trennt, markiert sichtbar und eindeutig die Linie zwischen zwei Besitztümern (auch wenn es um sie immer wieder zum Rechtsstreit kommt), wer aber den ersten Grenzposten zwischen zwei Ländern passiert, hat damit die Grenze noch lange nicht überschritten. Erst wenn man auch die Kontrolle des Einreiselandes durchlaufen hat, ist der Wechsel von einem Staatsgebiet zum anderen abgeschlossen.
Wo aber beginnt hier die Grenze und wo hört sie auf? Welchen rechtlichen Bedingungen unterliegt der Zwischenraum? Und greift bei ihm nicht eine zeitliche Komponente, der zufolge die Grenze in Abhängigkeit zur Dauer bemessen werden muss, innerhalb derer man sie durchschreitet? Grenzen als Zonen haben offensichtlich einen anderen Status als klar definierte Grenzlinien. Sie sind nicht ausschließlich über ihren Status der Negation charakterisierbar, sondern weisen ein nicht geringes Potenzial an Eigendynamik auf,[4] das kultur- und medienwissenschaftliche Theorien als Hybridform beschreiben, durch die alternative Identitätskonzepte und produktive Weisen der Begegnung möglich werden.[5]
Die Gegensätze im begrifflichen Radius der Grenze zeigen sich nicht zuletzt daran, dass Akte der Begrenzung sowohl positiv als auch negativ bewertet sein können. So stellen strikte Grenzziehungen im Sinne von Ausschlusspraktiken – sei es aufgrund der Religion, des Geschlechts oder der Hautfarbe – Formen der Gewaltausübung dar, während andererseits subkulturelle oder künstlerische Gruppenbildungen Freiräume eröffnen können, die dem Status der Abgrenzung einen positiven Stellenwert zusprechen. Gleiches gilt für die Übertretung von Grenzen, die beispielsweise mit dem menschlichen Entdeckungseifer positiv besetzt sein können, die aber ebenso – denkt man an die Schaffung künstlicher Intelligenz – Bedrohungs- und Untergangsszenarien heraufbeschwören. Grenzen sind also nicht gleich Grenzen, und wenn man verstehen will, woher sie die breite Bedeutungsspannweite nehmen, dann muss man einen Blick werfen auf die Geschichte ihres Begriffs und die Kontexte, in denen er verwendet wurde.
Begriffs- und Bedeutungsgeschichte
Das Wort „Grenze“ stammt als Lehnwort aus dem Slawischen (von polnisch granica und tschechisch hranice) und ist bereits für das 13. Jahrhundert belegt. Seine Verbreitung findet es allerdings erst im 16. Jahrhundert durch Martin Luthers Bibelübersetzung. Hierzu heißt es im „Deutschen Wörterbuch“ von Jakob und Wilhelm Grimm, Luther habe „geradezu eine vorliebe für das wort“[6] gehabt. Eine Stellenkonkordanz zu anderen Übersetzungen zeigt dabei auf, dass Luther „Grenze“ vor allem anstatt „Landmarke“ benutzte, also vorwiegend einen territorialen Einschnitt damit meinte, der einen Besitzstand angibt. Gerade dieser Zusammenhang von Eigentum und lokaler Begrenzung gilt als ursprünglicher Gebrauchskontext des Begriffs, der sich erst mit der Herausbildung der Nationalstaaten auf einen politischen Aspekt verlagert hat. Weil im 19. Jahrhundert die Macht nicht mehr nur im Zentrum des Territoriums, sondern auch an seinen Außengrenzen verortet wird, verblasst damit einhergehend auch die Praxis, eine größere Region als Grenze zu bezeichnen. Erweiterungen auf eine abstrakte und temporale Begriffsverwendung – etwa im Hinblick auf die Grenzen des Wissens oder die Grenzen einer historischen Epoche – kommen dagegen im 18. und 19. Jahrhundert auf.
Über die spezifischen Verwendungsweisen hinaus liefert das Grimm’sche Wörterbuch zwei aufschlussreiche Bedeutungsvarianten für das Liminale, die sich seit dem 16. Jahrhundert herauskristallisiert haben: Eine erste beschreibt die Grenze als „gedachte linie, die zur scheidung von gebieten der erdoberfläche dient; der sprachgebrauch vergröbert vielfach den begriff, indem er ihn überträgt auf die äuszeren merkmale, denen die grenze folgt, z.b. wälle, wasserläufe, gebirgszüge“.[7] Bemerkenswert an dieser Definition ist der bereits skizzierte Zusammenhang von sichtbarer Formation und mentaler Einstellung, die hier als sprachliche Vergröberung und Übertragung charakterisiert wird, darin aber die grundlegende Konstruktion von Grenzen bestätigt.
Die zweite Bedeutung bietet eine überraschende Erkenntnis, denn unser alltagssprachlicher Gebrauch von Grenzen als ein klarer Abschluss erweist sich in der Geschichte des Begriffs als recht späte semantische Ergänzung: „während der begriff grenze im ursprünglichen sinne auf der vorstellung eines raumes diesseits und jenseits der scheidelinie fuszt, entwickelt sich wesentlich erst seit dem 18. Jh. ein gebrauch, der von dem raum jenseits der grenze mehr oder weniger absieht und das wort so den bedeutungen ‚schranke, abschlusz, ziel, ende‘ nähert.“[8] Wichtig an dieser Einschränkung ist, dass das Verständnis von Grenzen als strikter Abschluss doch wiederum eine Vorstellung ihrer Überschreitung nach sich zieht im Sinne eines Rechtsbruchs oder allgemein als Verstoß gegen die mit der Limination verbundenen Reglementierungen. Auch Vorstellungen von Grenzenlosigkeit und Unendlichkeit tauchen als Kehrseite dieser Begriffsverwendung seit dem 18. Jahrhundert auf.
In diesem Zusammenhang kann eine andere wortgeschichtliche Herleitung aufzeigen, dass die Mehrdeutigkeit der Grenze nicht nur auf eine Bedeutungserweiterung zurückzuführen ist, sondern auch mit der begrifflichen Herkunft zusammenhängt. So wird der Terminus in dem von Friedrich Kluge begründeten „Etymologischen Wörterbuch der deutschen Sprache“ neben seinem slawischen Ursprung mit dem germanischen Wort „Granne“ in Verbindung gebracht, das mit „Borste, Stachel an Mensch, Tier u. Pflanze“[9] übersetzt wird und im Mittelhochdeutschen sogar nur die Haarspitze meint. Grenze ist unter diesem Gesichtspunkt etwas, das nicht wirklich einem Objekt (hier: dem Körper) zugehört, aber auch noch nicht ganz von ihm unterschieden ist. Mit diesem Weder-noch erscheint die Grenze als eine fragile Angelegenheit, deren verschiedene, zum Teil widersprüchliche Nuancen es verlangen, dass die jeweilige Bedeutung aus dem Verwendungskontext erschlossen werden muss, in dem sie aktualisiert wird.
Andererseits eröffnet gerade die semantische Vielfalt der Grenze produktive Diskurse des Uneindeutigen, die vor allem in der Literatur aufzufinden sind. Es wundert daher nicht, dass es in der europäischen Literatur zahlreiche Auseinandersetzungen mit dem Phänomen der Grenze gibt, bei denen der Begriff zum Teil gegen die gängigen Bedeutungsvarianten eingesetzt und um neue Aspekte erweitert wird.[10] Auch deshalb ist es nicht unproblematisch, wenn das Grimm’sche Wörterbuch die Bedeutungsgeschichte hauptsächlich anhand literarischer Beispiele erschließt. Literarische Verwendung und alltagssprachlicher Gebrauch von Diskursen verhalten sich nicht zwangsläufig kongruent zueinander.
Grenzen aus philosophischer Perspektive
In der Philosophie kommt der Grenze als eigenem Phänomen lange Zeit keine Aufmerksamkeit zu. Vielmehr rückt sie eher unfreiwillig ins Blickfeld, da die zentrale Frage der Unterscheidung – sei es der zwischen Natur und Kultur, Sein und Nichtsein oder Kunst und Nicht-Kunst – zwangsläufig die der Abgrenzung einschließt. In diesem Sinne wird sie erstmals eingehender von Immanuel Kant thematisiert, dem es in seiner „Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik“ (1783) um die Erfassung der Grenzen menschlicher Erkenntnisfähigkeit geht. Im Unterschied zu dem oben aufgezeigten Weder-noch der Grenze wendet Kant deren Bedeutung in ein Sowohl-als-auch. Eine Grenze ist für ihn „etwas Positives (…), welches sowohl zu dem gehört, was innerhalb derselben, als zum Raume, der außer einem gegebenen Inbegriff liegt“.[11]
Der Grund für diese positive Konzeption liegt darin, dass es Kant um die Grenzen der Vernunft geht, und diese eröffnen seinem Verständnis nach zugleich eine Ahnung von dem, was außerhalb ihrer Reichweite liegt, und haben insofern – und sei es minimal – daran teil. Die äußersten Ränder der Erkenntnis als bestimmt durch etwas zu begreifen, das als Unbestimmtes ihren Horizont übersteigt, adelt die Vernunft in ihrer Kompetenz, die eigenen Grenzen überhaupt denken zu können. Kants terminologischer Versuch indes, mit der Grenze ausschließlich etwas Positives zu verbinden und die negativen Eigenschaften dem Begriff der Schranke zu übertragen, hat sich nicht durchgesetzt. Allerdings können seine Überlegungen dazu beitragen, jede Form der strikten Grenzziehung – insbesondere, wenn sie politisch motiviert ist – als Illusion zu entlarven. Denn über den Ausschluss bleibt das andere immer präsent.
In dieser dialektischen Weise konzipiert auch Georg Wilhelm Friedrich Hegel die Grenze in seiner „Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften“ (1817/1830), wobei ihr eine weitaus existenziellere Bedeutung zukommt als bei Kant: „Die Negation ist im Dasein mit dem Sein noch unmittelbar identisch, und diese Negation ist das, was wir Grenze heißen. Etwas ist nur in seiner Grenze und durch seine Grenze das, was es ist. Man darf somit die Grenze nicht als dem Dasein bloß äußerlich betrachten, sondern dieselbe geht vielmehr durch das ganze Dasein hindurch. Die Auffassung der Grenze als einer bloß äußerlichen Bestimmung des Daseins hat ihren Grund in der Verwechslung der quantitativen mit der qualitativen Grenze. Hier ist zunächst von der qualitativen Grenze die Rede. Betrachten wir z.B. ein Grundstück, welches drei Morgen groß ist, so ist dies seine quantitative Grenze. Weiter ist nun aber auch dieses Grundstück eine Wiese und nicht Wald oder Teich, und dies ist seine qualitative Grenze. – Der Mensch, insofern er wirklich sein will, muß dasein, und zu dem Ende muß er sich begrenzen.“[12]
Die besondere Rolle, die Hegel im Unterschied zur quantitativen der qualitativen Grenze zuspricht, hat mit ihrer bedeutungskonstitutiven Funktion zu tun: Während die eine nur das Maßverhältnis angibt, trägt die andere zur semantischen Unterscheidung der Phänomene bei. In seinen weiteren Ausführungen präzisiert Hegel die qualitative Grenze als ein widersprüchliches Phänomen, weil sie „einerseits die Realität des Daseins“ ausmacht – eben in ihrer Sinnstiftung – und andererseits „dessen Negation“.[13] Bezogen auf den Menschen ist damit gemeint, dass sich jede und jeder abgrenzen muss, um sich als Individuum entwerfen zu können, damit aber auf die Grenze angewiesen bleibt als etwas, welches das Abgegrenzte zum Anderen macht und seinerseits von beiden unterschieden ist.
Für die Grenze selbst hat dies zur Folge, dass sie nach Hegel nicht als ein „abstraktes Nichts“, sondern als „seiendes Nichts“[14] aufgefasst werden muss. Diese Formulierung bringt auf den Punkt, dass Grenzen per se eigentlich nicht definiert werden können und doch eine existenzielle Bedeutung aufweisen. Sie zeigt allerdings auch das ganze Dilemma auf, das man sich mit dem Nachdenken über das Liminale einhandelt, weil es nur noch in einer paradoxen Wendung greifbar wird.
Dass gerade die Grenze als eine paradoxe Figur im Kontext postmoderner Philosophiekonzepte diskutiert wird, überrascht wenig. Neben generellen Infragestellungen – „No border is guaranteed, inside or out“[15] – bei Jacques Derrida, der mit seiner Dekonstruktion ohnehin Randgänge der Philosophie praktizierte,[16] findet sich eine aufschlussreiche Besprechung in einem Aufsatz des französischen Ideengeschichtlers Michel Foucault aus dem Jahr 1963 mit dem Titel „Préface à la transgression“ (Vorrede zur Überschreitung). Schon die Überschrift deutet an, dass es auch hier um die Grenze als eine dialektische Figur geht, allerdings zielt Foucault nicht auf ihre negative Existenzform ab wie Hegel, sondern definiert sie über ihr anderes, nämlich ihre Missachtung: „Grenze und Übertretung verdanken einander die Dichte ihres Seins: Inexistenz einer Grenze, die absolut nicht überschritten werden kann; umgekehrt Sinnlosigkeit einer Übertretung, die nur eine illusorische, schattenhafte Grenze überschritte.“[17] Als ein „Sich-Kreuzen von Seinsformen“ in einer „sich spiralig einrollenden Beziehung“[18] sind Grenze und Übertretung über ein komplexes Zusammenspiel miteinander verbunden.
Foucaults Überlegungen scheinen auf den ersten Blick hilfreich zu sein, weil sie den Anstoß dafür geben, Grenzen als dynamische Gebilde zu begreifen. Was allerdings genau mit der Spiralbewegung gemeint sein soll, bleibt unklar. Auch die Definition von Übertretung als Seinsform ist nicht unproblematisch, handelt es sich dabei doch um einen Vorgang und nicht um einen Zustand. Und schließlich ist kritisch anzumerken, dass Foucaults Definition – trotz aller Dialektik – selbst zu eindimensional auftritt, weil sie übersieht, dass Grenzen verschiedene Formen der (geduldeten und nicht geduldeten) Übertretung aufweisen können. Insofern müsste präzisiert werden, wer wann wo und unter welchen Umständen Grenzen passieren darf und wer nicht. Damit ist grundsätzlich die Frage zu stellen, ob man der Grenze tatsächlich gerecht wird, wenn man sie ausschließlich theoretisch abhandelt, oder ob ihre Semantik sich nicht eher anhand ihrer jeweiligen Verfahren und Anwendungsweisen erschließt.
Praktiken der Grenze
Die Semantik der Grenze über ihre Praktiken zu bestimmen, heißt, sie als ein Instrument zu verstehen, mit dessen Hilfe soziale Beziehungen geregelt werden, die mitunter sehr ungleich erscheinen können. Bedenkt man beispielsweise, dass das Mittelmeer jährlich von zahlreichen europäischen Touristen überflogen wird und gleichzeitig die europäische Grenzschutzagentur Frontex Flüchtlinge von dessen Überquerung abhält, dann zeigt sich in zynischer Weise, dass Grenzen unterschiedliche Grade der Durchlässigkeit aufweisen. Man muss daher von einer „selektive(n) soziale(n) Wirksamkeit und Wahrnehmungsfähigkeit von Grenzen“[19] sprechen, wodurch deutlich wird, dass sich die Ambivalenz der Grenze als strikter Abschluss und Ort der Übertretung an dem gleichen konstruierten Einschnitt zeigen kann. Da auch Grenzpraktiken nicht an bestimmte Orte gebunden sind – Festnahmen von illegal Eingewanderten geschehen trotz der Einreisekontrollen an den EU-Außengrenzen auch im Landesinneren –, zeigen sie sich nicht ausschließlich über fest installierte territoriale Markierungen, sondern als ein Zusammenspiel von Diskursen, Praktiken und Institutionen,[20] bei denen verschiedene Akteure im Sinne eines Machtapparates über Inklusionen und Exklusionen entscheiden.
Jenseits dieser politischen Beispiele finden im Zusammenleben der Mitglieder einer Gesellschaft ständig Grenzpraktiken statt, vom Bildungssektor über den Sportverein bis hin zum Gesundheitssystem. Immer geht es dabei um Statusfaktoren, die über Zugangsberechtigungen und Privilegien entscheiden. Jede und jeder besitzt eine ganze Reihe von Gruppenzugehörigkeiten, verfügt also über ein persönliches Konglomerat an Grenzöffnungen und -schließungen, welches das eigene soziale Leben strukturiert. Hegels Diktum, dass Grenzen durch das ganze Dasein hindurchgehen, hat hier seine ganz konkrete Bewandtnis.
Unter dem Gesichtspunkt der Vollzugsform lässt sich das Liminale als ein Akt der sozialen Verständigung bestimmen, wobei hierunter nicht das Ideal einer machtfreien Kommunikation gemeint ist, sondern im Gegenteil eine auf Machtfaktoren begründete Übereinkunft, mit deren Hilfe sich eine Gemeinschaft nach außen abgrenzt und nach innen die Verhaltensweisen im Zusammenleben reguliert. Diese Übereinkunft als Handlungsform kann als Akt verbaler Artikulation auftreten, etwa wenn jemand durch Beschimpfungen ausgegrenzt oder über einen Sprachritus in eine Gemeinschaft aufgenommen wird. Sie zeigt sich aber ebenso an internalisierten Verhaltensmustern.
Für alle Grenzpraktiken gilt, dass sie an das strukturelle Kriterium der Wiederholung gebunden sind. Denn es genügt nicht, dass Grenzen errichtet werden. Sie müssen immer wieder Sichtbarkeit erlangen, um Gültigkeit zu beanspruchen. Umgekehrt bedeutet dies aber auch, dass sie veränderbar sind.
Damit sei zum Schluss angedeutet, dass das Nachdenken über die Ambivalenz der Grenze dazu beitragen kann, allzu strikte Grenzpraktiken kritisch zu hinterfragen. Es soll damit dem Liminalen keine moralische Relevanz zugesprochen werden, die es an sich gar nicht besitzen kann. Aber wenn es darum geht, seine identitätsstiftende Funktion in Anspruch zu nehmen, muss sie auch denjenigen zugesprochen werden, von denen man sich unterscheidet: Das eine und das andere werden durch die Grenze gleichermaßen in ihr Recht gesetzt.
Die Einsicht in den Konstruktionscharakter dieser Praxis braucht also nicht zu einem Pessimismus zu führen, dem zufolge Grenzen überall und nirgends zugleich anzutreffen sind. Vielmehr gilt es, in der Variabilität von Grenzen eine produktive Möglichkeit zu sehen, sich selbst und die Praktiken des sozialen Umgangs immer wieder neu zu entwerfen.
Fußnoten
1. Diese und die folgenden Überlegungen basieren auf meiner einleitenden Darstellung zum Sammelband „Topographien der Grenze“ und ergänzen sie um wesentliche Aspekte. Vgl. Christoph Kleinschmidt, Formen und Funktionen von Grenzen. Einleitung zu einer interdisziplinären Grenzforschung, in: ders./Christine Hewel (Hrsg.), Topographien der Grenze. Verortungen einer kulturellen, politischen und ästhetischen Kategorie, Würzburg 2011, S. 9–21.
2. Vgl. Lucien Febvre, Das Gewissen des Historikers, hrsg. und aus dem Französischen übersetzt von Ulrich Raulff, Berlin 1988, S. 27–37.
3. Vgl. Norbert Wokart, Differenzierungen im Begriff der „Grenze“. Zur Vielfalt eines scheinbar einfachen Begriffs, in: Richard Faber/Barbara Naumann (Hrsg.), Literatur der Grenze – Theorie der Grenze, Würzburg 1995, S. 275–289.
4. Vgl. zu verschiedenen Modellen von Grenzübergängen: Rolf Parr, Liminale und andere Übergänge. Theoretische Modellierungen von Grenzzonen, Normalitätsspektren, Schwellen, Übergängen und Zwischenräumen in Literatur und Kulturwissenschaft, in: Achim Geisenhanslüke/Georg Mein (Hrsg.), Schriftkultur und Schwellenkunde, Bielefeld 2008, S. 11–64.
5. Vgl. Homi K. Bhabha, Die Verortung der Kultur, Tübingen 2010; Rainer Guldin, Ineinandergreifende graue Zonen. Vilém Flussers Bestimmung der Grenze als Ort der Begegnung, in: C. Kleinschmidt/C. Hewel (Anm. 1), S. 39–48.
6. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm, 16 Bde. in 32 Teilbänden, Leipzig 1854–1961, Quellenverzeichnis Leipzig 1971, Spalten 124–153, hier: Spalte 125 (Kleinschreibung im Original), http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&mode=Vernetzung&lemid=GG27579« (15.11.2013).
7. Ebd., Spalte 127 (Kleinschreibung im Original).
8. Ebd., Spalte 134 (Kleinschreibung im Original).
9. Artikel zu „Grenze“ in: Friedrich Kluge, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, Berlin–New York 197521, S. 269.
10. Vgl. Monika Ehlers, Grenzwahrnehmungen. Poetiken des Übergangs in der Literatur des 19. Jahrhunderts. Kleist – Stifter – Poe, Bielefeld 1997; Eva Geulen/Stefan Kraft (Hrsg.), Grenzen im Raum – Grenzen in der Literatur, Zeitschrift für deutsche Philologie, Berlin 2010.
11. Immanuel Kant, Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können, eingeleitet und mit Anmerkungen hrsg. von Konstantin Pollok, Hamburg 2001, §59, S. 150.
12. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Werke 8. Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse (1830), Erster Teil: Die Wissenschaft der Logik. Mit den mündlichen Zusätzen, neu editierte Ausgabe, Frankfurt/M. 1970, S. 197 (Hervorhebungen im Original).
13. Ebd.
14. Ebd.
15. Jacques Derrida, Living On. Border Lines, in: Deconstruction and Criticism, hrsg. von Harold Bloom et al., London–Henley 1979, S. 78.
16. So der Titel einer seiner Schriften. Vgl. Jacques Derrida, Randgänge der Philosophie, Wien 1996.
17. Michel Foucault, Zum Begriff der Übertretung, in: ders., Schriften zur Literatur, München 1974, S. 73.
18. Ebd.
19. Andrea Komlosy, Zwischen Sichtbarkeit und Verschleierung. Politische Grenzen im historischen Wandel, in: C. Kleinschmidt/C. Hewel (Anm. 1), S. 87–104, hier: S. 90.
20. Vgl. Sabine Hess/Bernd Kasparek (Hrsg.), Grenzregime. Diskurse, Praktiken, Institutionen in Europa, Berlin–Hamburg 2010.
Dieser Text ist unter der Creative Commons Lizenz „CC BY-NC-ND 3.0 DE – Namensnennung – Nicht-kommerziell – Keine Bearbeitung 3.0 Deutschland“ veröffentlicht. Autor/-in: Christoph Kleinschmidt für bpb.de